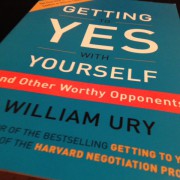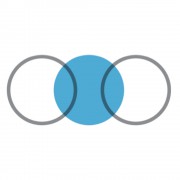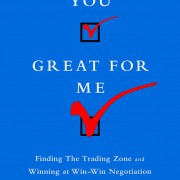Getting to Yes: Die Geschichte des Harvard-Konzepts
Allein in den USA wird alle drei Minuten ein Exemplar verkauft: Der Verhandlungsklassiker Getting to Yes – in Deutschland besser bekannt als das Harvard-Konzept – ist auch 34 Jahre nach seinem Erscheinen noch hochaktuell. Inzwischen wurde das Buch in über dreißig Sprachen übersetzt und viele Millionen mal gekauft und gelesen. Dabei war der überwältigende Erfolg des Werkes anfangs alles andere als absehbar: Sechs Monate nach dem Verkaufsstart mussten die Autoren noch Anzeigen schalten, um den Absatz anzukurbeln.
Getting to Yes entstand aus einem Diplomatenratgeber
Ein Beitrag im Negotiation Journal 2006 (Wheeler/Waters, Negot. J. 2006, 475-481) erzählt die Geschichte der Entstehung von Getting to Yes: In den 1970er Jahren war einer der Autoren, William Ury, im Rahmen seines Anthropologie-Studiums auf der Suche nach irgendeinem neuen wissenschaftlichen Thema – Hauptsache praxisrelevant. Er stolperte über eine Friedenskonferenz zum Nahen Osten, entwickelte einige Ideen zu zielführendem diplomatischem Konfliktmanagement und wandte sich damit an Roger Fisher, der damals bereits eine Professur an der Harvard Law School innehatte. Fisher hatte sich schon seit Längerem mit der Vermittlung in internationalen Konflikten beschäftigt und empfing den jungen Anthropologiestudenten mit offenen Armen. Bald stieß auch der dritte Autor, Bruce Patton, hinzu. Gemeinsam erstellten sie zunächst ein Loseblatt-Handbuch für Vermittler im diplomatischen Dienst. Die Kernidee: Effektive Konfliktlösung erfordert gemeinsames Handeln. Die Arbeit der drei Wissenschaftler verstetigte sich, und 1979 gründeten sie zusammen das Harvard Negotiation Project, aus dem wenig später das Program on Negotiation an der Harvard Law School hervorging. Bruce Patton war mit den explodierenden Projektaktivitäten gar so beschäftigt, dass er für sein Jurastudium am Ende sechs statt der üblichen drei Jahre benötigte.
Manuskript beharrlich laut vorgelesen
Bis zur Fertigstellung von Getting to Yes im Jahr war es allerdings noch ein langer Weg. Der endgültigen Publikation ging eine Reihe von Interviews mit Verhandlern und Mediatoren voraus, mit denen die Autoren ihre Thesen überprüften. Zudem legte Roger Fisher sehr großen Wert darauf, den Manuskripttext so lange laut vorzulesen, bis er sich auch im gesprochenen Wort gut anhörte. Schließlich kürzten die Autoren noch aus dem fertigen Manuskript 100 Seiten heraus, um ihre Erkenntnisse so präzise und kondensiert wie möglich zu fassen. Auch über den Buchtitel dachten sie lange nach. Ury hatte zunächst grammatikalische Skepsis, dann folgten die Autoren letztlich aber doch dem Vorschlag des Verlagsangestellten Richard McAdoo, das Buch Getting to Yes zu nennen.
Heute bildet Getting to Yes eine wichtige Grundlage für Verhandlungs- und Mediationsausbildungen auf der ganzen Welt. Mit ihrem Plädoyer für die Betonung von Interessen statt Positionen und für eine strenge Trennung von Person und Sache haben Fisher, Ury und Patton die spätere Literatur zu Verhandlungen und Konfliktlösung nachhaltig geprägt. Nur eine nicht-autorisierte japanische Übersetzung hat das Buch einmal gründlich missverstanden: Dort wurden die Ratschläge aus Getting to Yes ganz nonchalant ergänzt um den Hinweis, gute Verhandler sollten anfangs möglichst viel vom Gegenüber beanspruchen. Das war tatsächlich nicht im Sinne der Erfinder.