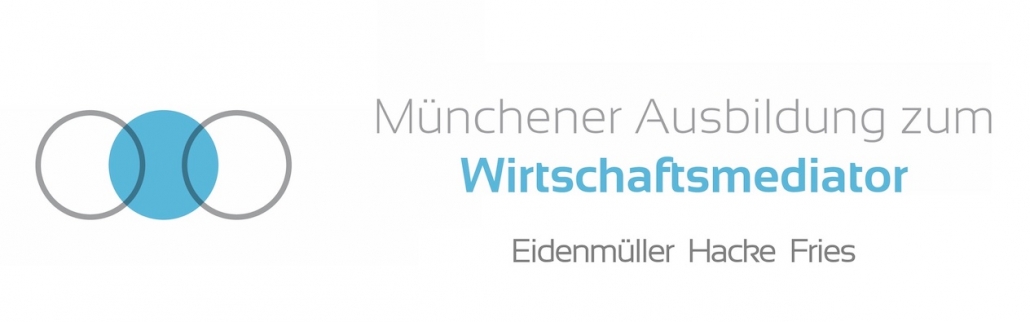Am Dienstag, 4. Juni 2024, um 16.00 Uhr bietet die Münchener Ausbildung zum Wirtschaftsmediator eine kostenfreie Online-Informationsveranstaltung zur nächsten Mediationsausbildung an. Die Veranstaltung richtet sich an Interessentinnen und Interessenten, die eine Teilnahme am nächsten Lehrgang der Ausbildung zum Wirtschaftsmediator ab September 2024 erwägen. Wir informieren Sie über den Aufbau und die wesentlichen Inhalte der Ausbildung; zudem besteht die Gelegenheit, Fragen zur Ausbildung unmittelbar an uns als Veranstalter zu richten. Sie können sich über eine eigene Seite für die Veranstaltung anmelden. Herzlich willkommen!
Seit dem heutigen 1. März 2024 gilt die Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung, ZMediatAusbV) in ihrer neuen Fassung. Die wesentlichen Änderungen sind eine leichte Erhöhung der Pflichtausbildungsstunden, die Möglichkeit zur Verlagerung eines Teils der Ausbildung in den virtuellen Raum sowie die Einbeziehung weiterer vier Praxisfälle für die erstmalige Erlangung der Bezeichnung „zertifizierter Mediator“. Entscheidend für die Frage, ob die alten oder die neuen Zertifizierungsregeln zur Anwendung kommen, ist der Beginn der Mediationsausbildung: Für alle ab dem heutigen Tag beginnenden Lehrgänge gelten die neuen Regeln. Eine übersichtliche Darstellung der neuen Voraussetzungen für die Zertifizierung einschließlich der Übergangsregeln finden Sie auf einer eigenen Seite unserer Homepage.
Den aktuellen Text der Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren können Sie HIER einsehen.
How could efficient judicial dispute resolution systems for B2B commercial disputes be designed in a digital world? As the artificial intelligence (AI) wave has gained momentum on an unprecedented scale in the last three years, we have recently interviewed 24 senior legal practitioners and business leaders, and we conducted an online survey which returned 275 responses from dispute resolution professionals worldwide. The majority of survey participants practice in the United States, in the United Kingdom, in Germany and in France. We argue that courts are also an indispensable part of the civil justice infrastructure for B2B commercial disputes. As far as stakeholder preferences are concerned, we find that the push for digitization and for using AI tools to improve the efficiency of judicial proceedings is strong. AI applications have already become a cornerstone of dispute resolution practice. “Online courts” should be “on offer” in commercial disputes. Providing user-friendly and reliable digital / AI tools for information management and analysis, communication and decision-making is key, as are clear protocols for online hearings. But disputing parties do not want to be judged by machines. Rather, they request competent and specialized human decision-makers. Courts need to be on top of the game with respect to the subject matter of the dispute. Parties also request planning and efficient case management. A case management conference and a process plan are essential. Finally, courts should offer an “early neutral evaluation” – a non-binding preliminary evaluation be a third party, with or without (mediated) settlement discussions – if the parties agree to this in the case management conference.
Our survey is available for download at SSRN free of charge. A short version of our study has been published on the Oxford Business Law Blog.
Der nächste Lehrgang der Münchener Ausbildung zum Wirtschaftsmediator findet ab September 2024 auf Schloss Hohenkammer nördlich von München statt. Die Ausbildung berücksichtigt bereits die ab 1. März 2024 geltenden Änderungen der Ausbildungsregeln für zertifizierte Mediatoren. Gerne können Sie sich bei einer der Online-Informationsveranstaltungen persönlich über den Lehrgang informieren.
Modularer Aufbau der Mediationsausbildung 2024
Kern der Ausbildung sind drei viertägige Module, die jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf Schloss Hohenkammer in der Nähe des Münchener Flughafens stattfinden. Wer die Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ anstrebt, kann die dafür erforderlichen Ausbildungsstunden durch ein eintägiges Online-Modul und ein abschließendes Vier-Tage-Modul vervollständigen. Die Zertifizierungsmodule lassen sich auch noch nachträglich hinzubuchen. Die Termine der einzelnen Module sind folgende:
- 26. bis 29. September 2024: Verhandlungsmanagement
- 7. bis 10. November 2024: Idealtypische Wirtschaftsmediation
- 28. November bis 1. Dezember 2024: Fortgeschrittene Wirtschaftsmediation
- 13. Dezember 2024: Online-Mediation (optional)
- 16. bis 19. Januar 2025: Komplexe Wirtschaftsmediation (optional)
Gerne können Sie sich im Rahmen eines kostenfreien Online-Informationsgesprächs über unser Angebot informieren. Die nächsten Termine dafür sind der 24. Januar 2024 und der 6. März 2024, jeweils von 17.00 bis 18.00 Uhr über Zoom. Sie können sich auf einer eigenen Seite unverbindlich für diese Online-Veranstaltungen anmelden.
Konzept und Anmeldung zur Mediationsausbildung
Nähere Informationen zum Konzept der Ausbildung finden Sie an anderer Stelle auf dieser Homepage. Die Rahmenbedingungen der Ausbildung können Sie hier einsehen. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls online über diese Webseite. Wenn Sie einzelne Module der Ausbildung buchen möchten oder Fragen zur Mediationsausbildung haben, kontaktieren Sie uns gerne.
Am heutigen Tag wurden die Änderungen der Regeln für zertifizierte Mediatoren (ZMediatAusbV) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die Neufassung der Verordnung tritt am 1. März 2024 in Kraft. Was ist neu und was müssen angehende Mediatorinnen und Mediatoren beachten?
Künftig später statt schneller zertifizierter Mediator
Wie bereits im Entwurf der Verordnungsnovelle geplant war, erfahren die Regeln für zertifizierte Mediatoren drei wesentliche Änderungen:
- Nunmehr muss der Ausbildungslehrgang einen Umfang von mindestens 130 statt zuvor 120 Stunden haben. Dafür kommen Online-Mediation und Digitalkompetenz als Pflichtinhalte des Lehrgangs hinzu.
- Während eine Online-Ausbildung zum zertifizierten Mediator bisher nicht möglich war, soll virtueller Unterricht nunmehr im Umfang von max. 40%, also 52 Zeitstunden, möglich sein. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Anwesenheitsprüfung. Zudem müssen Lehrkräfte und TeilnehmerInnen persönlich miteinander kommunizieren können. Ein Zoom-Meeting erfüllt diese Voraussetzung ebenso wie ein Livestream mit offenem Chat.
- Die wichtigste Änderung der Zertifizierungsregeln ist die zeitlich deutlich nach hinten verlagerte Berechtigung, sich als zertifizierte Mediatorin oder zertifizierter Mediator zu bezeichnen. Sowohl nach alter wie auch nach neuer Rechtslage müssen Zertifizierungskandidaten fünf Mediationsfälle akquirieren und supervidieren lassen. Während sie sich bisher bereits nach der ersten Supervision als „zertifiziert“ bezeichnen dürfen, müssen sie dafür künftig aber bis zum Abschluss der fünften Supervision warten. Der schnelle zertifizierte Mediator ist damit passé.
Was die Zertifizierungs-Novelle nicht regelt…
Eine Reihe von Vorschlägen zur Überarbeitung der Zertifizierungsregeln hat das Bundesjustizministerium nicht aufgegriffen. Auf absehbare Zeit nicht geben wird es
- eine zentrale Prüfstelle für zertifizierte Mediatoren,
- eine der Zertifizierung vorausgehende Prüfung von Zertifizierungskandidaten,
- gesetzliche Regeln für eine Mediatorenkammer.
Bei diesen Themen blieb das Stimmungsbild unter Mediations-Stakeholdern bis zuletzt uneinheitlich. Das BMJ hat es deswegen beim kleinsten gemeinsamen Nenner belassen. Im Hinblick darauf, dass nicht wenige Stimmen den Mediationsmarkt bereits heute für überreguliert halten, erscheint diese Lösung auch sachgerecht.
Schnell noch die alte Zertifizierung mitnehmen?
Die Verordnungsnovelle tritt am 1. März 2024 in Kraft; ab diesem Tag gelten die neuen Zertifizierungsregeln. Wer noch unter dem alten Recht in den Genuss des schnell-zertifizierten Mediators kommen möchte, kann dies relativ einfach tun. Denn nach § 7 Abs. 4 der neugefassten Verordnung darf man sich noch unter den alten, geringeren Voraussetzungen als zertifizierte(r) Mediator(in) bezeichnen, wenn man bis zum 29. Februar 2024 einen Ausbildungslehrgang beginnt und bis zum 29. Februar 2028 diesen Lehrgang abschließt und fünf Praxisfälle in Einzelsupervisionen reflektiert.
Der nächste Lehrgang der Münchener Ausbildung zum Wirtschaftsmediator beginnt am 14. September 2023. Anmeldungen sind gegenwärtig noch möglich über unser Online-Anmeldeformular.
Im Anschluss an ein vor eineinhalb Jahren veröffentlichtes Diskussionspapier hat das Bundesministerium der Justiz nun einen Entwurf für Änderungen an den Regeln für zertifizierte Mediatoren (pdf) vorgelegt. Was soll sich ändern und welche Punkte stehen noch zur Debatte?
Kernpunkte der geplanten neuen Zertifizierungs-Verordnung
Im Kern soll sich die Zertifizierungsverordnung (ZMediatAusbV) nach dem vorliegenden Entwurf ab Anfang 2024 in drei Punkten ändern:
- Der Umfang der erforderlichen Ausbildungsstunden soll sich moderat von 120 auf 130 Zeitstunden erhöhen.
- Davon sollen 40%, also 52 Stunden, virtuell unterrichtet werden können.
- Die Praxisanforderungen sollen erheblich verschärft werden: Während heute ein supervidierter Praxisfall genügt, um sich erstmals als zertifizierter Mediator oder zertifizierte Mediatorin bezeichnen zu können, sollen künftig fünf Praxisfälle erforderlich sein. Bisher waren die Fälle 2 bis 5 Bestandteil der Fortbildungsverpflichtung und erfuhren weniger Aufmerksamkeit, weil die Zertifizierungsbezeichnung bereits vorher geführt werden durfte.
Keine Veränderung gibt es hingegen beim grundlegenden Konzept der Verordnung: Anders als der Begriff „Zertifizierung“ suggeriert, werden Mediatorinnen und Mediatoren auch in Zukunft keine Prüfung bestehen, sondern nur einen Lehrgang besuchen und die geforderten Fallsupervisionen durchlaufen müssen (vgl. auch die pdf-Synopse der alten und der geplanten neuen Regeln).
Online-Ausbildung zum zertifizierten Mediator künftig zulässig?
In einem zeitgleich mit dem Entwurf für die Verordnungsänderung veröffentlichten Begleitschreiben (pdf) zeigt sich das Ministerium offen für eine Debatte über Umfang und Rahmenbedingungen virtueller Ausbildungsteile. Zum einen überlegt das BMJ, ob die Zulässigkeit virtueller Ausbildungsteile im Umfang von maximal 40% der geforderten Präsenzzeitstunden sachgerecht ist oder ein höherer Anteil bis hin zu einer reinen Online-Ausbildung zum zertifizierten Mediator zulässig sein sollte. Zum anderen stellt das Ministerium die Frage, ob das Erfordernis von fünf supervidierten Praxisfällen sinnvoll ist und inwieweit sich ein höherer Online-Anteil des Ausbildungslehrgangs durch eine größere Zahl von Praxisfällen kompensieren lassen sollte. Verbände und interessierte Fachkreise können sich hierzu bis zum 28. April 2023 äußern. Dabei ist tendenziell zu erwarten, dass der vorgelegte Entwurf keine wesentlichen Änderungen mehr erfährt. Denn mit dem Abklingen der Covid-19-Pandemie hat auch der Druck zur Verlagerung von Mediationsausbildungen in den virtuellen Raum nachgelassen. Und die Praxisanforderungen vor erstmaliger Führung der Zertifizierungsbezeichnung möchte das Ministerium bewusst erhöhen, um den Vorwurf zu entkräften, der zertifizierte Mediator sei ein unerfahrener Mediator.
Folgen für die Mediationsausbildung
Für den Mediations-Ausbildungsmarkt bedeutet das: Der Weg zum zertifizierten Mediator wird mit den neuen Praxisanforderungen so lang, dass viele Ausbildungsteilnehmer freiwillig auf die Zertifizierung verzichten werden. Wem die Bezeichnung als „zertifizierter Mediator“ trotz allem sehr wichtig ist, kann immerhin kurzfristig noch von der alten Regelung profitieren. Denn § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 der novellierten Ausbildungs-Verordnung soll eine Alte-Hasen-Regel enthalten, wonach für diejenigen Mediatoren noch die alten, niedrigeren Zertifizierungs-Anforderungen gelten, die ihre Ausbildung bis Ende 2023 beginnen und bis Ende 2027 den Lehrgang abschließen. Zulässig wäre es also, im Jahr 2023 einen Mediationslehrgang zu starten, ihn im Jahr 2025 zu beenden, dann binnen Jahresfrist einen Praxisfall supervidieren zu lassen und sich danach sogleich als zertifizierte Mediatorin zu bezeichnen. Um vier weitere Praxissupervisionen kommt man freilich auch in diesem Fall nicht herum, sie müssen ebenfalls bis Ende 2027 erfolgen, allerdings darf die Zertifizierungsbezeichnung im Unterschied zur geplanten künftigen Rechtslage eben schon vor Durchlaufen dieser weiteren Supervisionen geführt werden.
Sobald die endgültige Version der Zertifizierungs-Novelle feststeht, erhält auch unsere Informationsseite zum zertifizierten Mediator ein entsprechendes Update.
Können sich Fachanwältinnen und Fachanwälte eigentlich eine Mediationsausbildung als Fortbildung im Sinne von § 15 der Fachanwaltsordnung (FAO) anrechnen lassen?
Fortbildungspflicht für Fachanwälte nach § 15 FAO
Die Fortbildungspflicht für Fachanwältinnen und Fachanwälte regelt § 15 der Fachanwaltsordnung. In dessen Abs. 1 S. 2 und 3 heißt es:
„Wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, muss kalenderjährlich auf diesem Gebiet wissenschaftlich publizieren oder an fachspezifischen der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstaltungen hörend oder dozierend teilnehmen. Die hörende Teilnahme setzt eine anwaltsorientierte oder interdisziplinäre Veranstaltung voraus.“
Anbieter von Anwaltsseminaren haben eine Reihe unterschiedlicher Standardfortbildungen im Programm, die spezifisch für eine der inzwischen 24 verschiedenen Fachanwaltschaften als Fortbildung aufgesetzt und ausgeflaggt sind. Wie aber verhält es sich mit nicht fachanwaltsorientierten Veranstaltungen wie einer Mediationsausbildung? Sind sie „fachspezifisch“ im Sinne von § 15 FAO?
Mediationsausbildung als fachspezifische Fortbildung?
Die Antwort lautet wie so häufig: Es kommt darauf an! Lehrreich im Hinblick auf die Anforderungen an die fachspezifische Ausrichtung einer Fortbildung ist eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2016. Seinerzeit hatte der BGH – noch zur alten Rechtslage, aber insoweit ohne Unterschied – zu entscheiden, ob eine Fortbildung zu „Vernehmungslehre und Vernehmungstaktik“ ausreichend fachspezifisch ist, um als Fortbildung für Fachanwälte für Verkehrsrecht anerkannt zu werden. (BGH v. 18. Juli 2016, AnwZ (Brfg) 46/13, Volltext). Die drei Kernerkenntnisse aus der BGH-Entscheidung lauten:
- Eine Fortbildung im Sinne von § 15 FAO muss den Bezug zu einer bestimmten Fachanwaltschaft nicht im Veranstaltungstitel tragen.
- Eine Fortbildung im Sinne von § 15 FAO darf sich nicht auf juristische Grundkenntnisse beschränken, wie sie üblicherweise in Studium und Referendariat vermittelt werden.
- Ein Indiz für ausreichenden Fachbezug sind fachspezifische Fälle, die im Rahmen der Fortbildung bearbeitet werden.
Weil Mediationsfähigkeiten in Studium und Referendariat üblicherweise nicht vermittelt werden (Ausnahmen bestätigen die Regel), bedeutet das: Eine Mediationsausbildung ist ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung als Fortbildung nach § 15 FAO anerkennungsfähig, soweit sie Themen oder Fälle mit entsprechendem Fachanwaltsbezug bearbeitet. Das Wörtchen „soweit“ signalisiert dabei, dass eine Teilanrechnung der Mediationsausbildung in Betracht kommt. Entfallen beispielsweise 15 von 120 Ausbildungsstunden auf zwei erbrechtliche Fälle, kann die Ausbildung in diesem Umfang als Fortbildung für den Fachanwalt im Erbrecht gelten.
Was sagen die Kommentare zu § 15 FAO?
Dieses Verständnis von § 15 FAO findet sich auch in den einschlägigen Kommentaren zum anwaltlichen Berufsrecht. Hartmut Scharmer betont dabei im BORA/FAO-Kommentar von Harter/Scharmung (8. Aufl. 2022), dass das erst 2015 eingefügte Adjektiv „fachspezifisch“ keine zusätzliche Hürde darstellen soll; es genüge, wenn „der Seminargegenstand inhaltlich fachspezifisch“ ist (§ 15 FAO Rn. 34 und 40). Pro futuro wäre sogar eine weitergehende Anerkennung einer Mediationsausbildung denkbar, wenn man berücksichtigt, dass der Nutzen einer Fortbildung regelmäßig in der Transferleistung der Veranstaltungsteilnehmer besteht. Immerhin wird jede an einer Mediationsausbildung teilnehmende Anwältin die erlernten Mediationsfähigkeiten automatisch in ihre Erfahrungen einordnen und ihre fachspezifischen Fähigkeiten damit weiterentwickeln. Eine ähnlich großzügige Auslegung von § 15 FAO findet sich etwa bei Susanne Offermann-Burckart im BRAO-Kommentar von Henssler/Prütting (5. Aufl. 2019): Sie verlangt zwar ebenfalls einen nachvollziehbaren Bezug zu der geführten Fachanwaltschaft, hält es dabei aber ausdrücklich für zulässig, wenn ein Steuerrechtler ein Seminar zum Insolvenzrecht oder ein Insolvenzrechtler eine Steuerrechts-Tagung besucht (§ 15 FAO Rn. 43).
Vorab-Bestätigung durch die Kammer möglich
Das letzte Wort bei der Anrechnung von Fachanwalts-Fortbildungen hat in der Praxis die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer. Dort ist die o.g. Rechtsprechung in der Regel auch bekannt. Die Bestätigung der Anrechnung erfolgt häufig erst nachlaufend nach Einreichung der entsprechenden Fortbildungsnachweise. Zu einer Vorab-Bestätigung sind die Kammern nach dem o.g. BGH-Urteil nicht verpflichtet. Eine Anfrage bei der Kammer kann sich trotzdem empfehlen, denn bisweilen sind die Kammern doch zu einer formlosen Auskunft bereit, um Planungssicherheit zu ermöglichen.
Ende 2022 sorgte der Textautomat ChatGPT in den sozialen Medien für Furore. Technikaffine Angehörige sprach- und textproduzierender Berufe begannen zu überlegen, ob ihr Job künftig von einer künstlich intelligenten Software erledigt wird. Nun sind Mediatoren auf eine Weise auch Sprach- bzw. Sprechprofis. Wo könnte moderne Software wie ChatGPT mittelfristig in der Wirtschaftsmediation auftauchen?
Was ist ChatGPT genau?
Zunächst zum Hintergrund: ChatGPT ist eine Entwicklung von OpenAI und für jedermann nach Anlegen eines Accounts frei nutzbar. Vom Erscheinungsbild her erinnert das Tool an den Übersetzungsautomaten DeepL, der vor einiger Zeit Live-Übersetzungen revolutioniert hat und damit das Textarbeiten in fremder Sprache ermöglicht. Während DeepL allerdings „nur“ einen bereits existierenden Text übersetzt, erstellt ChatGPT den Text selbst. Dabei kann die Software sehr unterschiedliche Aufträge verarbeiten, von der Essayaufgabe zu einer bestimmten historischen Entwicklung über die Gestaltung eines Computerprogramms bis hin zur Erstellung von Rechtstexten. Im schlechteren Fall wird ChatGPT eine teilweise falsche Antwort aus frei verfügbaren Texten unbeholfen zusammenzimmern, im besseren Fall entsteht ein ganz neuer Text ohne fremde Urheberrechte, ggf. sogar mit korrekter Zitierung oder konkreten Handlungsempfehlungen.
Wie könnte man ChatGPT in der Mediation einsetzen?
Wenn man überlegt, wie man eine Medation durch eine solche Sprachproduktionssoftware anreichern kann, kommt einem vielleicht zuerst das Extrem in den Sinn: Ein Mediations- oder Schlichtungsautomat, der bei Eingabe einer Sachverhaltsschilderung Mitgefühl äußert und vielleicht sogar einen konkreten Lösungsvorschlag unterbreitet. Im Hinblick auf die Fehleranfälligkeit des Tools und auf die Intransparenz des Outputs erscheint dies allenfalls für Bagatellstreitigkeiten denkbar, die andernfalls überhaupt nicht bearbeitet werden. In der klassischen Wirtschaftsmediation sind Einsatzmöglichkeiten bescheidener, aber doch auch vorstellbar. So könnte ChatGPT etwa Vorschläge für die Kommunikation mit den Parteien liefern, Ideen für bisher noch nicht genannte Interessen einbringen oder einen ersten Entwurf für ein Vergleichsdokument erstellen. Auch das alles steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass alle Beteiligten bereit sind, ihre für die Anfrage an das Tool verwendeten Daten auch für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.
ChatGPT: Wie wäre es mit einem Test?
Das Bemerkenswerte an ChatGPT: Man kann sich der Software einigermaßen gefahrlos nähern und erst einmal experimentieren. Drei Beispiele:
Frage an ChatGPT: „Wie antworte ich auf eine Bitte, eine Auseinandersetzung als Mediatorin zu unterstützen, wenn ich gerne eine Kartellrechtsspezialistin als Co-Mediatorin hinzuziehen würde?“
Antwort von ChatGPT: „Ich danke Ihnen für Ihre Bitte, als Mediatorin zu unterstützen. Ich bin gerne bereit, Ihnen zu helfen, jedoch würde ich gerne eine erfahrene Kartellrechtsspezialistin als Co-Mediatorin hinzuziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte des Falls gründlich und kompetent bearbeitet werden. Ich denke, dass die Expertise dieser Person einen wertvollen Beitrag zur Auseinandersetzung leisten kann und kann Ihnen gerne einen oder mehrere Vorschläge für geeignete Co-Mediatoren machen. Wären Sie damit einverstanden?“
Oder wir beauftragen ChatGPT, uns bei der Suche nach Interessen etwas Schützenhilfe zu leisten:
Frage an ChatGPT: „Was sind typische Bedürfnisse der Kinder eines verstorbenen Menschen im Erbstreit?“
Antwort von ChatGPT: „Typische Bedürfnisse von Kindern eines verstorbenen Menschen im Erbstreit können sein:
- Finanzielle Sicherheit und Unterstützung
- Emotionale Unterstützung und Trauerbegleitung
- Klärung von Fragen bezüglich des Vermögens und des Erbes des verstorbenen Elternteils
- Aufrechterhaltung von Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freunden des verstorbenen Elternteils
- Sicherstellung, dass die Wünsche des verstorbenen Elternteils bezüglich des Erbes respektiert werden.“
Oder wir bitten ChatGPT um Ideen zu einer typischen Blockade gen Ende eines Mediationsverfahrens:
Frage an ChatGPT: „Wie kann ich als Mediator verhindern, dass die Parteien am Ende eines langen, konstruktiven Gesprächs doch wieder in eine Basarverhandlung abdriften?“
Antwort von ChatGPT: „Als Mediator gibt es einige Möglichkeiten, um zu verhindern, dass die Parteien am Ende eines langen, konstruktiven Gesprächs doch wieder in eine Basarverhandlung abdriften:
- Klare Erwartungen setzen: Zu Beginn des Mediationsprozesses sollten die Erwartungen an das Verfahren und die Verhaltensregeln klar festgelegt werden. Dies kann helfen, Basarverhandlungen zu vermeiden, indem man darauf hinweist, dass das Ziel darin besteht, eine gemeinsame Lösung zu finden.
- Fokus auf Interessen statt Positionen: Basarverhandlungen konzentrieren sich oft auf Positionen, anstatt auf die Interessen der Parteien. Als Mediator sollte man die Parteien dazu ermutigen, ihre Interessen zu artikulieren und zu erkunden, wie diese am besten befriedigt werden können.
- Verständnis fördern: Basarverhandlungen entstehen oft aus Unwissenheit oder Missverständnissen. Als Mediator sollte man darauf achten, dass die Parteien ein gegenseitiges Verständnis für ihre Positionen und Interessen entwickeln.
- Alternativen aufzeigen: Basarverhandlungen können entstehen, wenn die Parteien denken, dass es keine andere Option gibt. Als Mediator sollte man die Parteien dazu ermutigen, verschiedene Alternativen zu erwägen und zu diskutieren, um die Auswahl zu erweitern.
- Zeitmanagement: Basarverhandlungen können entstehen, wenn die Parteien sich in einer Sackgasse befinden und keine Fortschritte machen. Als Mediator sollte man darauf achten, dass der Prozess auf Kurs bleibt und die Parteien dazu ermutigen, konstruktiv weiterzuarbeiten.“
Die zweite Antwort ist meist besser als die erste
Die Beispiele zeigen: ChatGPT wirkt keine Wunder, gibt aber regelmäßig hilfreiche Denkanstöße. Es gibt gute Gründe, das Tool nicht im Plenum einer Mediation einzusetzen. Bei der Vorbereitung des Verfahrens kann die Software aber durchaus nützlich sein. Jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollte man den automatisch produzierten Text freilich nicht ungeprüft verwenden, sondern aufmerksam gegenlesen. Ein Tipp zum Schluss: Am Ende einer Antwort von ChatGPT lässt sich die Antwort „regenerieren“, also ein zweites Mal erstellen. Die Erfahrung zeigt: Die zweite Antwort ist meist besser als die erste…
In eigener Sache: Kurz vor Weihnachten 2022 ist das Buch „Mediation im Erbrecht“ von Martin Fries und Ralf Deutlmoser erschienen. Worum geht es und wie kommt man daran?
Erbstreit als Paradefall für die Mediation
Erbrechtliche Streitigkeiten finden in der Literatur zur außergerichtlichen Streitbeilegung selten Erwähnung, sind aber Paradefälle für eine kooperative Konfliktlösung. Denn es geht regelmäßig um viel Geld, um starke Emotionen und um das Bedürfnis nach echtem gegenseitigen Gehör. Hinzu kommt, dass der Erbrechtsprozess mit häufig mehreren Klagestufen und Instanzen ausgesprochen aufwändig ist, wohingegen bei einer schnellen Einigung die realistische Aussicht winkt, die Angelegenheit dauerhaft erledigt zu haben. Schließlich müssen die Hinterbliebenen eines Verstorbenen zwar zuweilen Erberwartungen aufgeben, sie zahlen aber auch im Falle eines Kompromisses nichts aus eigener Tasche, sondern gewinnen Vermögenswerte hinzu. Das erleichtert es den Parteien sehr, sich auf ein kooperatives Konfliktlösungsverfahren einzulassen.
Erbmediation im Anwaltsmandat
Viele Anwältinnen und Anwälte integrieren die Möglichkeit einer Mediation bereits systematisch in die Beratung ihrer Mandanten. Gerade in rechtlich anspruchsvollen Fällen mit vielen Beteiligten oder schwierigen steuerrechtlichen oder international-privatrechtlichen Anschlussfragen hilft eine Streitbeilegung auch allen Beteiligten, die Komplexität der Angelegenheit einigermaßen einzuhegen. Das gilt natürlich auch für den Erbstreit im Familienunternehmen, wo die Alternative eines Gerichtsprozesses wegen der damit verbundenen Presseberichte besonders unattraktiv ist. Gerade in Fällen dieser Tragweite werden anwaltliche Begleiter regelmäßig bereits vor dem Versterben des Erblassers gemeinsame Planungsschritte einleiten und dabei mediative Methoden einsetzen.
Mediation im Erbrecht im Open Access verfügbar
Das Buch zur Mediation im Erbrecht wendet sich vor diesem Hintergrund nicht nur an Mediatorinnen und Mediatoren, sondern gerade auch an Anwältinnen und Anwälte, die regelmäßig Erbrechtsmandate begleiten. Auch für Einsteiger und Teilnehmer einer Mediationsausbildung, die das Verfahren der Mediation mit besonderem Blick für eine praxisrelevante Materie studieren möchten, ist das Werk gut zu gebrauchen. Die Papierversion des Buches ist für € 53,49 im Handel erhältlich. Noch einfacher zugänglich ist die Open-Access-Publikation: Man kann das Buch auf den Seiten des Springer-Verlags kostenfrei online lesen oder auch frei als pdf herunterladen. Auf geht’s!
Im Herbst 2022 ist das Standardwerk „Wirtschaftsmediation“ aus der Feder des Frankfurter Rechtsanwalts Jörg Risse in zweiter Auflage erschienen. Was steht in dem Buch und wer sollte es lesen?
Grundlagen der Wirtschaftsmediation
Ziel des Werkes ist es, das Mediationsverfahren am Beispiel wirtschaftsrechtlicher Fälle praxisgerecht zu erläutern und zugleich die Pflichtinhalte der Ausbildung zum zertifizierten Mediator abdecken. Diesen Anspruch erfüllt das Buch voll und ganz. Am Beginn steht eine ausführliche Einführung in die methodischen Grundlagen von Verhandlungsmanagement und Mediation. Danach widmet sich Risse eingehend der für die Praxis außerordentlich bedeutsamen Frage, wie ein Fall den Weg zur Mediation findet. Anschließend stellt er die klassischen fünf Phasen der Mediation dar und erörtert die Rollen der verschiedenen Beteiligten. Gen Ende des Buches finden unter anderem der Rechtsrahmen für die Wirtschaftsmediation und die Grundlagen anderer Streitbeilegungsverfahren Erwähnung.
Standardwerk nicht nur für Wirtschaftsmediatoren
Vom Umfang her liegt das Buch von Jörg Risse oberhalb „unserer“ „Mediation in der Wirtschaft“ und unterhalb des „Handbuchs Mediation“ von Haft/Schlieffen. Auch wenn sich das Buch sehr flüssig liest, wird man es mit Blick auf seinen Umfang nicht an einem Wochenende durcharbeiten können. Es ist insofern nicht so sehr eine Lektüre zum Herunterlesen, sondern eher ein echtes Grundlagenwerk, das auch bei hohen rechtswissenschaftlichen und rechtspraktischen Ansprüchen keine Fragen offen lässt. Die Lesezeit ist aber gut investiert, und zwar nicht nur für Mediatorinnen und Mediatoren, sondern für die gesamte Breite der Prozessrechtspraxis. Denn mit Risse schreibt ein Litigation-Experte, der die Mediation nicht als Weltanschauung auf den Schild hebt, sondern sie auf solider theoretischer Grundlage als eines von mehreren ernstzunehmenden Verfahren der Konfliktlösung beschreibt. Das ist absolut lesenswert!
Das Buch „Wirtschaftsmediation“ von Jörg Risse ist im Versandhandel zum Preis von 129 € erhältlich.